Gendergerechte Sprache setzt sich mehr und mehr in unserem Alltag durch und wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir uns daran gewöhnt haben. Sprache ist flexibel und wandelt sich, das war schon immer so. Es ist ein Balanceakt, eine gendergerechte Sprache zu verwenden und gleichzeitig einen Text zu schreiben, der sich gut und flüssig liest. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, gendergerechte Sprache in Texten anzuwenden. Doch bestimmte Regeln sind allgemeingültig und solltest du beachten, wenn du dich dafür entscheidest, zu gendern. Diese Gender-Methoden gibt es:
1. Ausschreiben
Man kann sich die Mühe machen, alle Formen auszuschreiben. Das funktioniert manchmal gut:
Liebe Genossinnen und Genossen.
Aber auch das kann passieren:
Der Patient oder die Patientin geht zu seinem oder seiner bzw. ihrem oder ihrer Ärztin oder Arzt.
Zwar ist alles grammatikalisch korrekt, aber auch schrecklich unübersichtlich. Nachteil ist ebenso, dass weitere Geschlechter nicht berücksichtigt werden.
2. Binnen-I und Schrägstrich
Die Methoden des Binnen-I und des Schrägstrichs sind eher veraltet und werden immer seltener verwendet, da auch hier nur das männliche und das weibliche Geschlecht angesprochen werden. Weiterer Nachteil: Grammatikalisch wird vieles falsch wiedergegeben.
Liebe LeserInnen
Liebe Kund/innen
Die männlichen lieben Kunden werden hier grammatikalisch nicht korrekt abgebildet.
3. Abwechselnd
Eine gute Möglichkeit ist, abwechselnd männliche und weibliche Formen zu verwenden. Politikerinnen sprechen mit Bürgern und hoffen so, Wählerinnen und Unterstützer zu gewinnen. Ihr müsst nicht streng jeden Satz das Geschlecht wechseln, aber passt auf, nicht klischeehaft die Geschlechter zu verteilen. Sprecht also nicht nur von Arzthelferinnen und Automechanikern. Nachteil ist auch hier, dass weitere Geschlechter nicht berücksichtigt werden. Vorteil: Die Lesefreundlichkeit ist wesentlich höher als bei den anderen Methoden.
4. Gender-Gap, Doppelpunkt, Sternchen
Dann gibt es noch Gender-Gap, Doppelpunkt und Sternchen, wobei sich Letzteres durchzusetzen scheint. Vorteil ist hier, dass ihr weitere Geschlechter ansprecht. Nachteil: Oft sind diese Formen grammatikalisch falsch oder unübersichtlich, was für Personen, die Deutsch lernen oder kognitive Einschränkungen haben, zu einer schweren Verständlichkeit führt. Und der Lesefluss … ihr wisst schon. Der*Die Schaffner*in kontrolliert die*den Reisende*n. ein:e Leser:in Der_Die Bürger_in … Den Busfahrer*innen werden Pausen gegönnt. Hier wird die grammatikalisch korrekte Form „den Busfahrern“ erneut nicht wiedergegeben.
Aufgepasst! Bei allen Methoden solltet ihr folgende Punkte beachten:
- Wichtig ist, konsequent zu gendern. Wenn von Richter*innen, Jurist*innen und Zeug*innen die Rede ist, müsst ihr natürlich auch konsequent die Begriffe Täter*innen und Verbrecher*innen gendern.
- Bleibt bei einer Gender-Methode: mal Sternchen und dann wieder Schrägstrich nach Lust und Laune geht nicht.
- Für alle Methoden habt ihr die Möglichkeit, neutrale Formulierungen zu nutzen, z. B. Fahradfahrende, Personal, Team, Studierende.
Nachteil: Manche Formulierungen wirken sehr konstruiert und ungewöhnlich, z. B. zu Fuß Gehende, Autofahrende. Vielleicht ändert sich aber auch hier allmählich unser Sprachgefühl.
Manche Begriffe könnt ihr nicht neutral formulieren. Von Begriffen wie „Feuer löschende Personen“ für Feuerwehrfrauen und -männer rate ich ab, oder wie sollten Polizist*innen neutral benannt werden? Auch der Begriff der Ärzteschaft bildet nicht die Ärztin ab und fällt somit weg.
In vielen Texten stellt sich schnell die Frage, was eigentlich alles gegendert werden muss oder soll. Muss es konsequent Bürger*innenmeister*innen heißen? Ist es der Fußgänger*innenweg, auf dem ich laufe? Ist es falsch, nur von „Turnschuhproduzenten“ zu sprechen, wenn es sich lediglich um Firmen handelt?
Auf die Zielgruppe achten!
Mein Rat hier: Schaut euch zunächst an, an wen sich der Text richtet. Wenn es ein einfaches Kundenmagazin (Kund*innenmagazin?) ist, dann verzichtet lieber auf diese komplizierten Formen. Ist es ein politischer Text für bestimmte Organisationen, kann man schon eher darüber nachdenken. Ist die Leser*innenschaft älter oder jünger, eher konservativ oder progressiv?
Überlegt euch, ob der Plural weiterhelfen kann.
Aus dem Satz:
Der*Die Patient*in geht zu ihrem*ihrer seinem*seiner Ärzt*in.
wird:
Patient*innen gehen zu ihren Ärzt*innen. Drei Sternchen gespart, der Satz liest sich viel flüssiger.
Weitere Beiträge
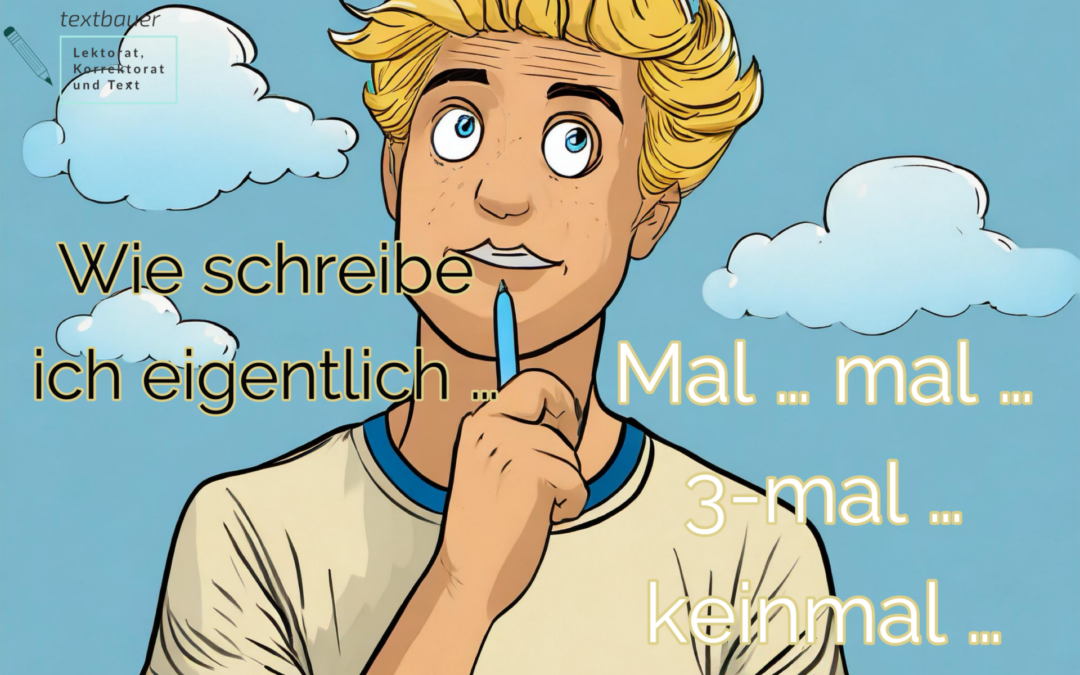
Groß, klein, zusammen, getrennt: Wie du „mal“ schreibst
Groß, klein, zusammen, getrennt: Wie du „mal“ schreibst, hängt davon ab, ob du es als Adverb, Substantiv oder Partikel verwendest.

Plural oder Singular bei elliptischen Sätzen
Ist Plural oder Singular korrekt bei elliptischen Sätzen, also wenn einzelne Wörter weggelassen werden? Und stimmt der Satz überhaupt?

Der Deppen-Dativ
Autoren wechseln gerne bei Aufzählungen plötzlich fälschlicherweise in den Dativ, statt beim Genitiv oder Akkusativ zu bleiben. Aber warum eigentlich?

Lieber aktiv als passiv schreiben
Warum du lieber im Aktiv als im Passiv schreiben solltest, liest du hier. Manchmal ist aber auch das Passiv von Vorteil!

Lautmalerei
Summen, quaken, knistern: Die Lautmalerei ist eine Technik, Klang und Geräusche mit Worten nachzuahmen, und bereichert unsere Kommunikation ungemein.

Wie du deinen Wortschatz erweiterst und abwechslungsreicher schreibst
In diesem Blogbeitrag werden wir einige bewährte Strategien erkunden, um deinen Wortschatz zu erweitern und abwechslungsreicher zu schreiben.
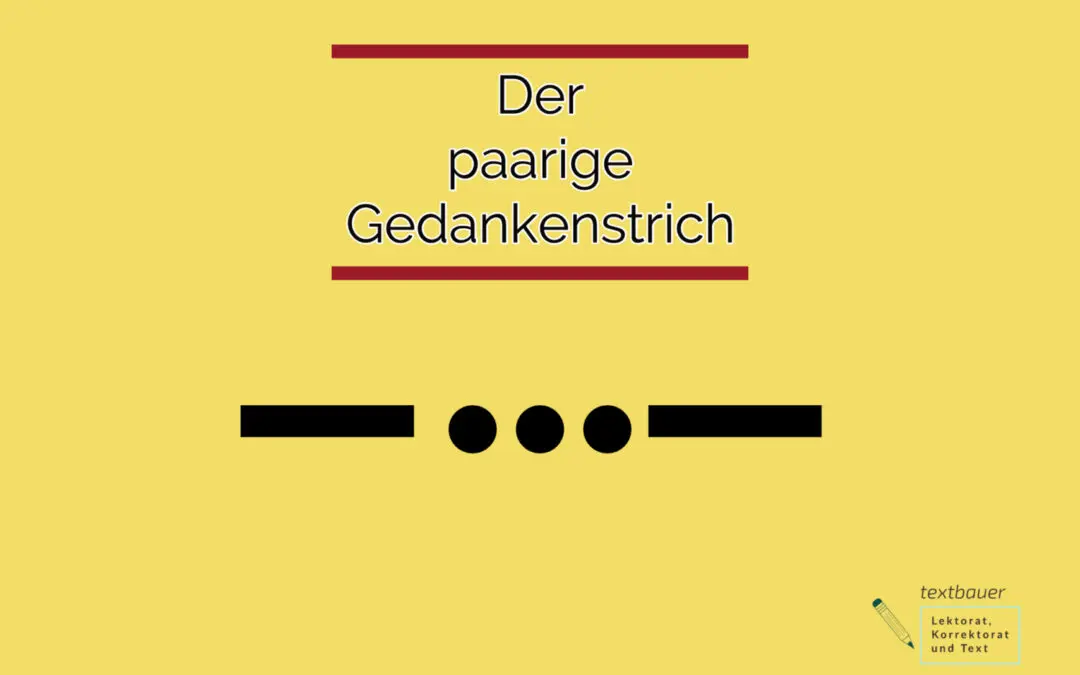
Der paarige Gedankenstrich
Der paarige Gedankenstrich ist eine gute Möglichkeit, um wichtige Bestandteile eines Satzes hervorzuheben. Lies dazu die wichtigsten Tipps!

Schiefe Sprachbilder
Schiefe Sprachbilder sind häufig ein Ärgernis. Lies hier, wie du sie vermeidest – und wann sie durchaus sinnvoll sind.

Abonniere meinenNewsletter
... und verpasse keine Neuigkeiten!
Du hast dich erfolgreich eingetragen!